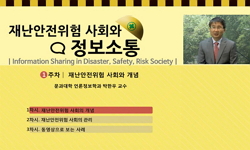Die Polizei kann je nach Ziel in Verwaltungspolizei und Justizpolizei eingeteilt werden. Die Justizpolizei ermittelt Verbrechen, sammelt Beweise und leitet den gesamten Fall für strafrechtliche Verfahren an die Staatsanwaltschaft weiter, um dem Verd�...
http://chineseinput.net/에서 pinyin(병음)방식으로 중국어를 변환할 수 있습니다.
변환된 중국어를 복사하여 사용하시면 됩니다.
- 中文 을 입력하시려면 zhongwen을 입력하시고 space를누르시면됩니다.
- 北京 을 입력하시려면 beijing을 입력하시고 space를 누르시면 됩니다.
경찰법상 위험의 구성요건화에 대한 연구 : 보호법익을 중심으로 = Eine Studie zur „Tatbestandalisierung‟ der Gefahren im Polizeirecht : Im Fokus des Schutzgüter
한글로보기부가정보
다국어 초록 (Multilingual Abstract)
Jedoch handelt die Polizei in der aktuellen Situation oft passiv gegenüber Gefahren im Sinne der Verwaltungspolizei, selbst wenn sie offensichtlich sind, und ergreift keine Maßnahmen oder argumentiert, dass, ohne einen Haftbefehl, die Polizei nicht eingreifen könne. Diese Einstellung reflektiert einen eher justiziellen Ansatz und eine passive Reaktion der Polizei auf Gefahren im Polizeirecht. Die Gründe dafür könnten sein, dass das Recht zur Anwendung von Polizeigewalt auf Verbrechen oder strafrechtliche Verfahren basiert, dass das Konzept der polizeilichen Gefahr nicht intuitiv im Rechtssystem erkennbar ist und keine klare Grundlage für die Einschätzung der Situation eines Polizeibeamten bietet, und dass die Regeln für Standardmaßnahmen der Polizei im Polizeigesetz unzureichend sind.
Das Konzept der Gefahr kann anhand von drei Elementen im Polizeirecht - Schutzinteressen, Schäden und Wahrscheinlichkeit - erfasst werden. Bisherige Studien konzentrierten sich jedoch hauptsächlich auf die Elemente der Schäden und der Wahrscheinlichkeit, während die Untersuchung der Schutzinteressen unzureichend war. Daher wurde Gefahr lediglich als Gegenbegriff zu "Sicherheit" betrachtet und es war schwierig, konkrete Arten und Formen von Gefahren sowie ihre eigentliche Natur zu erfassen.
In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf das Element der Schutzinteressen im Konzept der Gefahr und versuchen zu spezifizieren, welche Rechtsinteressen die Polizei schützen muss, um Polizeigewalt anzuwenden. Wir schlagen vor, diese zu typisieren und klare Kriterien für die Ausübung von Polizeigewalt festzulegen. Darüber hinaus beabsichtigen wir, die Befugnisse der Polizei innerhalb des bestehenden Systems des Polizeigesetzes zu klassifizieren und zu listen, indem wir sie nach ihrem administrativen Charakter einordnen und die Arten von Gefahren, die den Kriterien entsprechen, proportional festlegen. Wir hoffen auch, dass durch die klare Einführung eines allgemeinen Ermächtigungsparagraphen und die Festlegung von Kriterien die Kohärenz des polizeilichen Handlungsrechts gewährleistet und die Entwicklung des Polizeiverwaltungsrechts gefördert wird.
Durch diese Arbeit erhoffen wir uns, dass die moderne Polizei, die die Gefahr im Polizeirecht hauptsächlich als Kriterium für die Ausübung von Polizeigewalt betrachtet, zielgerichteter, problemorientierter und proaktiver wird und das Ermessen der Polizeibeamten effektiver nutzt.
Die Polizei kann je nach Ziel in Verwaltungspolizei und Justizpolizei eingeteilt werden. Die Justizpolizei ermittelt Verbrechen, sammelt Beweise und leitet den gesamten Fall für strafrechtliche Verfahren an die Staatsanwaltschaft weiter, um dem Verdächtigen eine Strafe auferlegen zu können. Die Verwaltungspolizei hingegen handelt, wenn eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, wie sie im Polizeirecht definiert ist, besteht, um diese zu verhindern und bereits eingetretene Schäden zu beseitigen. Mit anderen Worten, die Anforderungen an die Justizpolizei beziehen sich auf Verbrechen, während die Anforderungen an die Verwaltungspolizei auf Gefahren zurückzuführen sind. Ein Verbrechen wird als Handlung definiert, die bereits in der Realität besteht und für die es notwendig ist, strafrechtliche Sanktionen durch Gesetzgebung festzulegen. Somit fällt ein Verbrechen in die Unterkategorie der Gefahren.
Jedoch handelt die Polizei in der aktuellen Situation oft passiv gegenüber Gefahren im Sinne der Verwaltungspolizei, selbst wenn sie offensichtlich sind, und ergreift keine Maßnahmen oder argumentiert, dass, ohne einen Haftbefehl, die Polizei nicht eingreifen könne. Diese Einstellung reflektiert einen eher justiziellen Ansatz und eine passive Reaktion der Polizei auf Gefahren im Polizeirecht. Die Gründe dafür könnten sein, dass das Recht zur Anwendung von Polizeigewalt auf Verbrechen oder strafrechtliche Verfahren basiert, dass das Konzept der polizeilichen Gefahr nicht intuitiv im Rechtssystem erkennbar ist und keine klare Grundlage für die Einschätzung der Situation eines Polizeibeamten bietet, und dass die Regeln für Standardmaßnahmen der Polizei im Polizeigesetz unzureichend sind.
Das Konzept der Gefahr kann anhand von drei Elementen im Polizeirecht - Schutzinteressen, Schäden und Wahrscheinlichkeit - erfasst werden. Bisherige Studien konzentrierten sich jedoch hauptsächlich auf die Elemente der Schäden und der Wahrscheinlichkeit, während die Untersuchung der Schutzinteressen unzureichend war. Daher wurde Gefahr lediglich als Gegenbegriff zu "Sicherheit" betrachtet und es war schwierig, konkrete Arten und Formen von Gefahren sowie ihre eigentliche Natur zu erfassen.
In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf das Element der Schutzinteressen im Konzept der Gefahr und versuchen zu spezifizieren, welche Rechtsinteressen die Polizei schützen muss, um Polizeigewalt anzuwenden. Wir schlagen vor, diese zu typisieren und klare Kriterien für die Ausübung von Polizeigewalt festzulegen. Darüber hinaus beabsichtigen wir, die Befugnisse der Polizei innerhalb des bestehenden Systems des Polizeigesetzes zu klassifizieren und zu listen, indem wir sie nach ihrem administrativen Charakter einordnen und die Arten von Gefahren, die den Kriterien entsprechen, proportional festlegen. Wir hoffen auch, dass durch die klare Einführung eines allgemeinen Ermächtigungsparagraphen und die Festlegung von Kriterien die Kohärenz des polizeilichen Handlungsrechts gewährleistet und die Entwicklung des Polizeiverwaltungsrechts gefördert wird.
Durch diese Arbeit erhoffen wir uns, dass die moderne Polizei, die die Gefahr im Polizeirecht hauptsächlich als Kriterium für die Ausübung von Polizeigewalt betrachtet, zielgerichteter, problemorientierter und proaktiver wird und das Ermessen der Polizeibeamten effektiver nutzt.
국문 초록 (Abstract)
그러나 작금의 경찰은 행정경찰상 위험에 해당하는 것이 분명함에도 이것이 범죄가 아니라는 이유로 조치를 취하지 않거나, 영장이 없으면 경찰이 전혀 개입할 수 없다는 등 이른바 사법경찰적 관점에 천착하여 경찰법상 위험에 소극적으로 대응하고 있다. 위험(Gefahr)이 경찰활동의 대상이 된다는 것은 전통적인 견해이자 수 많은 연구들이 그간 축적되어 있음에도 불구하고, 현실에서는 그 인식이나 중요성이 절하되고 있는 것이다. 그리고 그 원인으로는 경찰권 발동의 근거가 되는 법률이 범죄 혹은 형사절차를 전제하고 있다는 점, 경찰법상 위험의 개념이 법 체계상 직관적으로 드러나지 않고 경찰관의 상황 판단 근거가 되지 못하고 있다는 점, 경찰작용법 상 경찰의 표준적 직무조치의 규율이 미비하다는 점을 지적할 수 있다.
위험의 개념은 경찰상 보호법익, 손해, 개연성의 3요소로 파악할 수 있으나, 지금까지의 연구는 손해, 개연성의 요소에 집중하고 보호법익에 대한 고찰이 미비한 이유로, 위험은 ‘안전(安全)’의 반대개념에 불과한 하나의 표상으로 인식될 뿐 구체적인 위험의 유형이나 양태, 그 본질에 대해서는 파악되기 어려운 측면이 있었다.
본고에서는 위험의 개념요소 중 보호법익에 집중하여, 경찰이 어떤 법익을 보호하기 위해 경찰권을 발동하여야 하는지를 구체화하고 그것을 유형화하여 경찰권 발동의 구성요건으로 명확히 규정하는 방안을 제시하고자 한다. 또한 법적 성격이 불분명한 표준적 직무조치가 혼재된 현재의 경찰작용법 체계 내에서 경찰의 권한을 행정법적 성격에 따라 분류하여 목록화하고, 권한의 강도에 따라 그 구성요건에 해당하는 위험의 유형을 비례적으로 규정하여 행정경찰의 수단 선택에 적절한 기준을 제시하고자 한다. 아울러 개괄적 수권조항의 명확한 도입과 구성요건의 규정을 통해 경찰작용법의 체계성을 확보하고 경찰행정법 도그마틱의 발전을 도모하고자 한다.
본고는 경찰법상 위험에 관한 그간의 연구들을 현실에 접목시키기 위한 첫 번째 발걸음이다. 경찰행정법학은 현실의 경찰활동을 행정법적으로 설명하는 데에 그치지 않고, 경찰의 행위규범으로서 지위를 정립함과 동시에 그 한계를 객관적으로 규율하는 역할을 수행할 필요가 있다. 결론적으로 경찰법상 위험을 구체화, 유형화하는 경찰법학의 정립은 현대의 경찰행정을 문제해결지향적인 관점에서 인식할 수 있도록 하고, 경찰권 발동의 근거를 명확히 고지할 수 있으며, 그 범위와 한계 또한 명확한 지침을 제시할 수 있는 방향으로 나아갈 수 있을 것이다.
경찰은 목적을 기준으로 행정경찰과 사법경찰로 분류될 수 있다. 사법경찰은 범죄를 수사하고 증거를 수집하여 피의자에게 형벌이 부과될 수 있도록 사건 일체를 형사절차에 회부하는 역할...
경찰은 목적을 기준으로 행정경찰과 사법경찰로 분류될 수 있다. 사법경찰은 범죄를 수사하고 증거를 수집하여 피의자에게 형벌이 부과될 수 있도록 사건 일체를 형사절차에 회부하는 역할을 하고, 행정경찰은 공공의 안녕과 질서라고 일컫어지는 경찰상 보호법익에 대한 위험이 발생할 경우 이를 방지하고 이미 발생한 장해를 제거하는 역할을 한다. 즉, 사법경찰의 요건은 범죄, 행정경찰의 요건은 위험이라고 할 수 있다. 범죄는 이미 현실화 된 위험 중 형벌을 부과할 필요성이 있는 행위를 입법을 통해 형사법상 구성요건으로 정해놓은 것으로, 범죄는 위험의 하위범주에 속한다.
그러나 작금의 경찰은 행정경찰상 위험에 해당하는 것이 분명함에도 이것이 범죄가 아니라는 이유로 조치를 취하지 않거나, 영장이 없으면 경찰이 전혀 개입할 수 없다는 등 이른바 사법경찰적 관점에 천착하여 경찰법상 위험에 소극적으로 대응하고 있다. 위험(Gefahr)이 경찰활동의 대상이 된다는 것은 전통적인 견해이자 수 많은 연구들이 그간 축적되어 있음에도 불구하고, 현실에서는 그 인식이나 중요성이 절하되고 있는 것이다. 그리고 그 원인으로는 경찰권 발동의 근거가 되는 법률이 범죄 혹은 형사절차를 전제하고 있다는 점, 경찰법상 위험의 개념이 법 체계상 직관적으로 드러나지 않고 경찰관의 상황 판단 근거가 되지 못하고 있다는 점, 경찰작용법 상 경찰의 표준적 직무조치의 규율이 미비하다는 점을 지적할 수 있다.
위험의 개념은 경찰상 보호법익, 손해, 개연성의 3요소로 파악할 수 있으나, 지금까지의 연구는 손해, 개연성의 요소에 집중하고 보호법익에 대한 고찰이 미비한 이유로, 위험은 ‘안전(安全)’의 반대개념에 불과한 하나의 표상으로 인식될 뿐 구체적인 위험의 유형이나 양태, 그 본질에 대해서는 파악되기 어려운 측면이 있었다.
본고에서는 위험의 개념요소 중 보호법익에 집중하여, 경찰이 어떤 법익을 보호하기 위해 경찰권을 발동하여야 하는지를 구체화하고 그것을 유형화하여 경찰권 발동의 구성요건으로 명확히 규정하는 방안을 제시하고자 한다. 또한 법적 성격이 불분명한 표준적 직무조치가 혼재된 현재의 경찰작용법 체계 내에서 경찰의 권한을 행정법적 성격에 따라 분류하여 목록화하고, 권한의 강도에 따라 그 구성요건에 해당하는 위험의 유형을 비례적으로 규정하여 행정경찰의 수단 선택에 적절한 기준을 제시하고자 한다. 아울러 개괄적 수권조항의 명확한 도입과 구성요건의 규정을 통해 경찰작용법의 체계성을 확보하고 경찰행정법 도그마틱의 발전을 도모하고자 한다.
본고는 경찰법상 위험에 관한 그간의 연구들을 현실에 접목시키기 위한 첫 번째 발걸음이다. 경찰행정법학은 현실의 경찰활동을 행정법적으로 설명하는 데에 그치지 않고, 경찰의 행위규범으로서 지위를 정립함과 동시에 그 한계를 객관적으로 규율하는 역할을 수행할 필요가 있다. 결론적으로 경찰법상 위험을 구체화, 유형화하는 경찰법학의 정립은 현대의 경찰행정을 문제해결지향적인 관점에서 인식할 수 있도록 하고, 경찰권 발동의 근거를 명확히 고지할 수 있으며, 그 범위와 한계 또한 명확한 지침을 제시할 수 있는 방향으로 나아갈 수 있을 것이다.
목차 (Table of Contents)
- 목 차
- 국문초록 · i
- 제 1 장 서론 · 1
- 목 차
- 국문초록 · i
- 제 1 장 서론 · 1
- 제 1 절 연구의 목적 1
- 제 2 절 연구의 의의 2
- 제 2 장 행정경찰의 역할과 중요성 · 6
- 제 1 절 개관 6
- 제 2 절 경찰활동의 두 축 – 행정경찰과 사법경찰 · 7
- I. 행정경찰과 사법경찰 개념의 비교 · 7
- 1. 행정경찰의 개념 7
- (1) 행정경찰의 임무 7
- (2) 행정경찰의 요건 9
- (3) 행정경찰의 대상 11
- 2. 사법경찰의 개념 13
- (1) 사법경찰의 임무 13
- (2) 사법경찰의 요건과 대상 · 14
- II. 행정경찰과 사법경찰의 차이 · 15
- 1. 적용 법규 16
- 2. 수단과 통제, 권리구제 18
- III. 중점이론에 의한 구별의 불필요성 23
- 1. 중점이론(Schwerpunkttheorie) · 24
- (1) 중점이론의 개념과 의의 · 24
- (2) 범죄의 수사 목적으로 간주되는 위험방지활동 · 25
- 2. 중점이론의 필요성에 대한 재고찰 · 26
- (1) 권리구제 측면에서의 불필요성 26
- (2) 위험방지 우선주의의 필요성 27
- 제 3 절 행정경찰 패러다임으로의 전환 필요성 28
- I. 법적으로 포섭된 경찰상황에의 의존 28
- 1. 형사법적 포섭으로 인한 이익형량의 실종 28
- 2. 경찰권 발동 수단의 형사법적 포섭 30
- II. 검거를 목적으로 한 피의자 중심적 사고 31
- III. 질서행정청과의 유기적 연계 부족 32
- 1. 실질적 의미의 경찰 32
- 2. 경찰행정청과 일반행정청의 연계 34
- 제 4 절 소결 35
- 제 3 장 형사법편향적 경찰활동의 법·이론적 원인 37
- 제 1 절 형사절차를 전제한 법적 구조 37
- I. 행정범의 과잉범죄화 · 37
- 1. 행정범과 형사범의 개념 37
- 2. 행정범의 과잉범죄화와 그 원인 38
- 3. 과잉범죄화와 경찰의 편향 39
- II. 행정경찰과 영장주의 40
- 1. 영장주의의 개념 40
- 2. 행정상 강제처분과 영장주의 41
- III. 위험방지와 형사소추의 중첩 43
- 1. 경찰법과 형사법의 경계 43
- 2. 사법경찰을 전제한 행정경찰작용법 44
- 제 2 절 경찰법상 위험 개념의 모호성 46
- I. 위험에 관한 선행연구의 한계 46
- 1. 개연성 위주의 연구 47
- (1) 구체적 위험과 추상적 위험 · 47
- (2) 객관적 위험과 주관적 위험 · 48
- (3) 외관상 위험, 위험의 혐의, 오상위험 49
- (4) 리스크와 위험의 전단계 · 50
- (5) 소결 51
- 2. 법치국가적 통제 위주의 연구 51
- II. 위험에 관한 법적 근거의 모호성 53
- 1. 경찰관직무집행법 상 위험의 위치 · 53
- 2. 형사법적 도식과의 비교 55
- 제 3 절 현장 경찰관의 재량행사와 부담 57
- I. 표준적 직무조치의 미비 · 57
- 1. 표준적 직무조치의 의의 57
- 2. 우리나라 표준적 직무조치의 미비점 58
- (1) 체계성의 부족 · 58
- (2) 수권내용의 부족 60
- (3) 소결 61
- II. 경찰관에 부여된 재량과 사후 통제 · 61
- 1. 경찰법상 재량의 의의 · 61
- 2. 재량행사의 부담 63
- 제 4 절 소결 65
- 제 4 장 위험의 구성요건화를 위한 대전제 67
- 제 1 절 위험의 도식화와 보호법익의 기능 · 67
- I. 위험의 도식 · 67
- II. 경찰상 보호법익의 의의 68
- 1. 형법에서의 보호법익 69
- 2. 경찰법에서의 보호법익 70
- 제 2 절 경찰상 보호법익의 구체화 71
- I. 협의의 행정경찰과 보안경찰 71
- II. 공공의 안녕과 질서 · 73
- 1. 개인적 법익 · 74
- 2. 국가적 법익 · 76
- 3. 사회적 법익 (객관적 법질서) · 78
- III. 법익침해 양태의 복합성 · 82
- 제 3 절 위험과 경찰상 조치의 관계 · 83
- I. 상당성 83
- II. 개연성(임박성) · 84
- III. 법익의 중요성 · 85
- 제 4 절 소결 86
- 제 5 장 보호법익을 중심으로 한 위험의 구성요건화 88
- 제 1 절 개관 88
- 제 2 절 경찰관직무집행법 상 보호법익의 명문화 90
- I. 위험방지에 관한 일반법적 지위 정립 · 90
- II. 구성요건화를 위한 일반규정의 필요성 · 91
- 1. 현행 경찰관직무집행법의 목적·직무 규정 91
- 2. 현행 경찰관직무집행법 상 일반 규정의 부재 93
- 3. 위험의 구성요건화를 위한 정의 규정 · 94
- 제 3 절 표준적 직무조치와 구성요건의 정립 96
- I. 표준적 직무조치에 대한 비교법적 분석 96
- 1. 현행 경찰관직무집행법 상 표준적 직무조치 · 96
- 2. 독일 경찰법 상 표준적 직무조치 97
- 3. 소결 99
- II. 위험의 유형화와 표준적 직무조치 100
- 1. 행정지도 · 100
- 2. 행정조사 · 101
- 3. 경찰하명 · 103
- 4. 즉시강제 · 105
- 5. 소결 106
- 제 4 절 개괄적 수권조항과 구성요건의 정립 107
- I. 개괄적 수권조항의 의의 · 107
- 1. 개괄적 수권조항의 개념 107
- 2. 개괄적 수권조항의 형식 108
- II. 개괄적 수권조항의 입법 필요성과 구성요건 110
- 1. 우리나라의 개괄적 수권조항과 필요성 110
- 2. 개괄적 수권조항과 구성요건 111
- 제 5 절 소결 114
- 제 6 장 결론 118
- 참고문헌 · 120
- Zusammenfassung 124